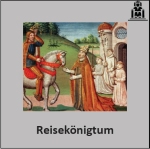Die Arbeit des Historikers ist schon oft mit der des Detektivs verglichen worden. Für den Unterricht nutzbar gemacht wurde das bislang kaum. Zu sehr orientiert sich seit der Hinwendung zur Quellenorientierung der Geschichtsunterricht an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit vor allem schriftlichen Texten.
Zur Zeit stark vor allem im Bereich der Mediendidaktik sehr en vogue ist die Idee des Game Based Learning (GBL), vereinfacht gesagt, geht es darum, durch Spaß am und im Spiel gezielte Lernprozesse anzuregen und zu unterstützen. Darin steckt meines Erachtens noch eine Menge bisher wenig beachtetes Potential für die Motivation im Geschichtsunterricht.
Hier möchte ich einen kleinen Vorschlag machen, wie man so die Idee spielerischer Detektivarbeit in jüngeren Klassen für historisches Lernen im Geschichtsunterricht nutzen kann. Inhaltlich steht im Mittelpunkt die Ermordnung des Tiberius Gracchus, ein Mordfall bei dem die Schüler im Gegensatz zu anderen berühmten, wie z.B. dem Caesars, in der Regel die Hintergründe nicht kennen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung. Im Gegensatz zu Christoph Kühberger sehe ich übrigens durchaus einen relevanten Gegenwartsbezug für die Behandlung der Reformen der Gracchen im Unterricht.
Die Schüler erhalten Rollenkarten mit der Aufgabe als Detektiv. Sie können auch kleine Teams bilden. Dazu gibt es sechs Rollen mit Vertretern verschiedener sozialer Schichten und Interessensgruppen aus dem alten Rom. Diese Personen müssen die Detektive befragen und aus ihren Erzählungen müssen sie versuchen, den Mordfall zu lösen. Wichtig ist, dass nicht nur nach dem oder den Mördern, sondern immer auch nach den Motiven gesucht wird. Das ist für das historische Lernen in diesem Zusammenhang entscheidend.
Die Hypothesen der Detektivgruppen können im Plenum vorgestellt und diskutiert werden. Je nach Zeitansatz und Lerngruppe lässt sich das Thema vertiefen, in dem die eigene Detektivarbeit reflektiert und eventuell mit einem Darstellungstext, z.B. aus dem Schulbuch, verglichen wird.
Die Texte finden sich hier als DOC-Datei zum Download. Sie können also modifiziert und dem eigenen Unterricht und der Lerngruppe angepasst werden.
Bei der Durchführung der Unterrichtsstunde hatte ich mit vier Schülern im Vorfeld die Übernahme der „Zeugen“-Rollen abgesprochen. Das war allerdings nicht ideal. Eine Alternative könnten virtuelle Avatare darstellen, die den Text sprechen. Vorteil ist, dass hier keine Rollenwechsel stattfinden (die Avatare werden ja nicht als Mitschüler angesprochen) und dass die Detektive individuell einzelne Texte so oft anhören können, wie nötigt und auch gezielt einzelne Passagen noch einmal abrufen können (an Computerstationen oder ihren eigenen mobilen Geräten mit Kopfhörern).
Wie so ein sprechender Avatar aussehen kann, lässt sich hier sehen. Die Figuren können per Link oder Einbettung in eine Lernplattform, ein Blog oder als QR-Code für die Schüler zur Verfügung gestellt werden. Allerdings gibt es noch ein Problem: Die Sprachwahl und -ausgabe bei Voki ist ziemlich gut. Das Progamm lässt sich auch ohne Anmeldung benutzen und stellt dauerhafte Links zu den erstellten Avataren bereit.
Doch die nicht sehr umfangreichen Texte der sechs Charaktere sind für Voki bereits zu lang und können nicht komplett eingegeben werden. Zudem ist die Auswahl an Avataren ist sehr begrenzt und für historische Themen kaum geeignet. Andere Programme wiederum ermöglichen das Hochladen von eigenen Bildern, die in beweglichen und sprechende Avatare konvertiert werden können, hier ist dann aber meines Wissens bislang keine Umsetzung in eine deutsche Sprachausgabe möglich.
Wenn jemand eine entsprechende Online-Anwendung oder App kennt, bitte ich um Hinweis: Dann ließen sich z.B. römische Büsten oder andere historische Abbildungen von Personen mit verschiedenen Stimmen zum Sprechen bringen und das wäre eine sehr spannende und motivierende Abwechslung für das Geschichtsunterricht!